Aus einer geschlossenen Alpha muss schnell eine offene Beta werden
Das Centre for Digital Cultures (CDC) der Leuphana Universität Lüneburg begrüßt die wegweisenden programmatischen Äußerungen der Bundesregierung in der heute vorgelegten „Digitalen Agenda“ und die damit verbundene Zielsetzung, den digitalen Wandel aktiv zu fördern, zu begleiten und abzusichern. Dennoch sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung nicht weitreichend genug und fallen an vielen Stellen hinter die klaren Ankündigungen des Koalitionsvertrags zurück. Das gefährdet auch die Wissenschaften als Treiber des gesellschaftlichen Wandels.
Die Bundesregierung macht an vielen Stellen deutlich, dass die Digitale Agenda nicht der Abschluss, sondern der Beginn der Konkretisierung von Maßnahmenpaketen ist und als „offener, alle gesellschaftlich relevanten Gruppen einschließender, nicht abschließender Prozess“ verstanden werden muss. Wir begrüßen daher insbesondere, dass die Bundesregierung das „kollektive Wissen in unserer Gesellschaft“ nicht nur in Form von Big-Data-Analysen nutzbar machen möchte, sondern in dem Dokument durchgängig zu Dialog, Teilhabe und Mitgestaltung auch durch Wissenschaft und Zivilgesellschaft aufruft.
Wir möchten diesem Aufruf folgen und mit ersten Überlegungen in das Gespräch über eine „Digitale Agenda für Deutschland“ aus der Sicht des Centre for Digital Cultures eintreten.
Die „Digitale Agenda“ für Deutschland braucht klare Kompetenzen
Die ersten Reaktionen auf die Digitale Agenda, nachdem Entwürfe verschiedenen Presseorganen zugespielt und von der Plattform für digitale Bürgerrechte Netzpolitik.org veröffentlich worden sind (in der Fassung vom 09. Juli 2014 und in der ressortabgestimmten Fassung vom 28. Juli 2014), waren vor allem kritisch: „eine Enttäuschung“, „nichts als heiße Luft“, „als habe ein besonders schlechter Algorithmus Bullshit-Bingo gespielt“, „viel zu vage und viel zu spät“. Kritik kam auch von den Verbänden. Sie beschreiben das vorliegende Papier als “ernüchternd” (BVDW) und bemängeln das Ausklammern des Themas Verbraucherschutz (VZBV), sowie die fehlende konkrete Mittelzuschreibung unter anderem beim Breitbandausbau (VATM/BITKOM/etc.).
Als einer der Gründe dafür wird weithin das Kompetenzgerangel zwischen den Koalitionsparteien und den Ressorts von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) genannt. Ein Internet-Ministerium, das dem Thema ein ähnliches Gewicht geben würde wie Verbraucherschutz und Umwelt, stand zwar mehrmals zur Debatte, ist aber letztendlich abgelehnt worden. Zwar hat die Regierungskoalition die Metapher von der Datenautobahn wörtlich genommen und ein Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingerichtet, diesem aber nur die undankbare Aufgabe des Breitbandausbaus und nicht die Zuständigkeit für die Digitale Agenda zugewiesen. Ähnliches gilt für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Überschneidung beim Thema Offene Daten zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und dem Bundesinnenministerium. Entsprechend knirschte es schon beim Auftakt der Digitalen Agenda auf der Cebit im März.
Die meisten Eckpunkte der aktuellen Digitalen Agenda waren bereits im Koalitionsvertrag im Dezember 2013 genannt. In den konkreten Maßnahmen fallen diese jedoch an vielen Stellen hinter das zurück, was der Koalitionsvertrag ursprünglich mit klarer Sprache zum Ausdruck gebracht hat. So hätte man sich gewünscht, die „klare Prioritätensetzung zugunsten von Bildung, Wissenschaft und Forschung, die im 10-Prozent-Ziel zum Ausdruck kommt,“ hier wiederzufinden. Hieß es damals „Bei der Ausschreibung werden Open-Source-Ansätze priorisiert“, heißt es nun: „Bei Beschaffungen der Bundesverwaltung bauen wir praktische Hemmnisse für Open Source Software (OSS) mit dem Ziel der Chancengleichheit weiter ab.“ Darüber hinaus ist unklar, warum die knapp 400 konkreten – oft interfraktionellen – Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft keine eindeutige Berücksichtigung in den Plänen der Bundesregierung gefunden haben. Schließlich stellt sich die Frage nach den Folgen des Papiers für das tatsächliche Handeln, wenn z.B. die Stärkung das Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durch Verbesserung der Ressourcenausstattung angekündigt, zeitgleich jedoch der Etat dieses digitalsten Kompetenzzentrums, über das die Bundesregierung verfügt, zusammengestrichen wird.
Positive Wirkung der Digitalisierung braucht von Beginn an echte Partizipation und einen offenen Dialog
Das CDC spricht sich klar für die Bundesregierung als Mittlerin in einem gesellschaftsweiten ergebnisoffenen Aushandlungsprozess aus und teilt die folgende Auffassung der Digitalen Agenda:
„Demokratie lebt von Teilhabe. Digitale Dienste ermöglichen dabei den verstärkten Dialog im demokratischen Raum und stellen Informationen bereit, die in der Vergangenheit häufig nur schwer zugänglich waren. … Das Internet … erleichtert die Partizipation an gesellschaftlichen Entwicklungen und Entscheidungsprozessen und stärkt damit die Grundlagen unserer Demokratie. Der Nutzen der digitalen Vernetzung zeigt sich auch bei der Bewältigung großer gesellschaftlicher Aufgaben…“
Dazu gehören auch die Herausforderungen der digitalen Transformation selbst. Bislang hat die Bundesregierung dieses Potential noch kaum genutzt. Stattdessen schaut der Ausschuss Digitale Agenda des Bundestages zwar gern über den Tellerrand, lässt sich aber nur ungern in die Karten blicken. Er tagt in der Regel nicht öffentlich und veröffentlich zwar Tagesordnungen, aber keine Protokolle. Auch der interministerielle Prozess der Ausarbeitung der Agenda verlief ohne Öffentlichkeit. Die Entwürfe wurden nicht offiziell veröffentlicht, sondern als von Bundesinnenminister Thomas de Maizière beklagte Leaks der Presse zugespielt. Selbst das federführende BMWi war im Rahmen der Vorveröffentlichung eines Entwurfs des Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) schon einmal weiter. Als konkreter Rückschritt, im Vergleich zum Koalitionsvertrag, muss an dieser Stelle auch das Fehlen der Ankündigung eines Beitritts zur Open Government Partnership (OGP) genannt werden. Ein frühzeitiger Beitritt zur OGP hätte sicher dazu beigetragen, dass Zivilgesellschaft, andere gesellschaftliche Gruppen und die Länder schon am Erstellungsprozess der Agenda strukturiert beteiligt gewesen wären.
Um den „Dialog der Bundesregierung mit allen relevanten Gruppen“ zu ermöglichen, so erklären es die Autoren der Agenda, soll als „gemeinsames Dach“ der NationaleIT-Gipfel, der bislang eher durch hohe Kosten und Ergebnislosigkeit gekennzeichnet war, geöffnet und neu ausgerichtet werden. Die im letzten ressortabgestimmten Entwurf enthaltene Aussage, dass die Bundesregierung in diesem Rahmen „flexibel und eigenverantwortlich Dialogplattformen“ etablieren möchte, wurde in der letzten Version der Agenda jedoch ersatzlos gestrichen. Es ist ausgesprochen unglücklich, dass die Autoren den Dialog nicht mit Beginn des Agendaprozesses gestartet haben und eine Online-Beteiligung und Mitgestaltungsmöglichkeiten, die schon bei der Internet-Enquete des Bundestages erst viel zu spät eröffnet wurden, nun offenbar nur noch auf kommunaler Ebene vorgesehen sind.
Digitale Kulturen und Medien müssen verstanden und nicht bekämpft werden
Die Agenda erkennt gleich zu Beginn an, dass die digitalen Technologien „die Schaffung und den Zugang zu Kulturgütern und medialen Inhalten sowie die Möglichkeiten der Meinungsbildung und -äußerung revolutioniert und demokratisiert“ haben. Vollmundig folgt die Erklärung der Bundesregierung, Deutschland zu einem „digitalen Kulturland“ machen zu wollen. Doch was sie unter digitalen Kulturen versteht, bleibt nebulös. Die Antworten, die Kultur- und Medienwissenschaftler in einem Forschungsprojekt des Digital Cultures Research Lab des Centre for Digital Cultures an der Leuphana Universität Lüneburg geben, zeigen die Vielfältigkeit der digitalen Kulturen, die es erst einmal zu verstehen gilt.
Die zu diesem Bereich in der Agenda genannten Maßnahmen richten sich vor allem auf Teilaspekte der digitalen Kulturen: Digitalisierung, Langzeitarchivierung und Zugänglichkeit von Kulturgütern. Kino und Film werden ausdrücklich genannt, einer der wenigen Zuständigkeitsbereiche der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Die Deutsche Digitale Bibliothek soll weiter ausgebaut werden. Die Digitalisate und deren Metadaten sollen „– soweit urheberrechtlich zulässig –“ offen und möglichst unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Leider sieht die Bundesregierung hier, anders als in der Wissenschaft, offenbar keinen urheberrechtlichen Handlungsbedarf.
Hier hätten wir uns einen Diskussionsvorschlag zu einer Remixing-Schranke gewünscht oder zumindest die Anerkennung der Tatsache, dass sich mit dem Zugang auch die Weiternutzung und Weiterverbreitung medialer Inhalte demokratisiert, diese Meinungsäußerungen zwar massenhaft, aber in einer rechtlichen Grauzone erfolgen. Stattdessen heißt es ausgerechnet im Abschnitt „VI.3. Verbraucherschutz“:
„Um Rechtsverletzungen vorzubeugen, werden wir die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer stärken und sie besser in die Lage versetzen, zwischen legalen und illegalen Angeboten im Netz zu unterscheiden.“
Man darf vermuten, dass Verbraucher vor Abmahnungen geschützt werden sollen, aber nicht etwa, indem dem Abmahnunwesen endlich ein Ende gesetzt wird, sondern durch Aufklärung. Die Unterscheidung von legalen und illegalen Angeboten fällt jedoch selbst Experten oft genug schwer. Genau diese Grauzonen sind gesetzgeberisch zu klären. Unter „revolutionierten“ Bedingungen werden immer wieder neue Nutzungen aufkommen, die gesellschaftlich gewünscht sind, aber urheberrechtlich ausgeschlossen. Um die dafür erforderliche Flexibilität zu schaffen, wird zunehmend die Einführung einer Fair-Use-Regelung vorgeschlagen – von der von CDU- und CSU-Abgeordneten gestarteten Initiative Faires Urheberrecht bis zu kritischen Juristen wie Till Kreutzer. Auch diesen Vorschlag sucht man in der Agenda vergeblich.
Auch die Medienordnung findet Erwähnung. Sie sei noch unter den Bedingungen der analogen Welt entstanden und solle nun den digitalen Gegebenheiten angepasst werden. Das Digitale tritt hier nicht als Revolution in Erscheinung, sondern als Konvergenz, nämlich der Massenmedien Presse und Rundfunk mit dem Massenindividualmedium Internet. Dass die Agenda die Wettbewerbsnachteile hervorhebt, zu denen eine inkonsistente Inhalteregulierung führen kann, deutet an, dass sie die Medienkonvergenz nicht unter dem Blickwinkel einer öffentlichen Grundversorgung oder der Demokratisierung der Meinungsbildung und -äußerung sieht, sondern unter dem eines Marktes. Kein Wunder, wenn das Wirtschaftsministerium die Federführung hat.
Zwei Maßnahmen nennt die Agenda dazu: Die Bund-Länder-Kommission für einen Medienstaatsvertrag solle baldmöglichst starten und Schnittstellen schaffen zwischen dem föderalen Rundfunk- und Medienrecht und dem Telekommunikations- und Wettbewerbsrecht des Bundes. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, der das Projekt maßgeblich betreibt, dämpfte in seiner Grundsatzrede zur Medienpolitik Anfang Juni die hohen Erwartungen. Er sprach von einem pragmatischen, langweilig wirkenden Ansatz, der Medienregulierung von Verbreitungswegen auf Inhalte umstellt und auf Urheberrecht, die Regulierung von Plattformen und Intermediären, Netzneutralität und Innovationsförderung abhebt. Eine Föderalismusreform und eine Harmonisierung des zersplitterten Medienrechts hält Scholz nicht für realistisch.
Angesichts solcher realpolitischer Verkürzungen sind grundsätzliche Überlegungen, informationelle Grundversorgung vom Internet aus neu zu denken, umso wichtiger, wie sie am Grundversorgung 2.0 Lab am Centre for Digital Cultures unternommen werden.
Zum anderen setze sich die Bundesregierung für eine Revision der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ein. Ebenfalls ohne zu verraten, in welcher Richtung.
Urheberrecht spielt in einer digitalen Agenda ohne Frage eine zentrale Rolle. Aus der aktuellen Agenda erfahren wir jedoch wenig mehr, als dass die Bundesregierung sich „aktiv in die Vorbereitungen der von der Europäischen Kommission angekündigten Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation und des Urheberrechts einbringen“ will.
Digitale Wissenschaften sind Schlüssel zu den Chancen der Digitalisierung
Positiv können die Ankündigungen einer umfassenden Open-Access-Strategie, einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht, einer Bildungsoffensive und nachhaltiger Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Infrastruktur hervorgehoben werden. Das Hybrid Publishing Lab am Centre for Digital Cultures hat die Notwendigkeit für eine konkrete Strategie für die Öffnung von wissenschaftlicher Kommunikation in Anlehnung an die Budapest Open Access Iniative immer wieder betont und unterstützt. Diese Aspekte des netzpolitischen Regierungsprogramms stellen zeitgemäße und notwendige Signale dar, um Deutschland im Bereich der Wissenschaft und Bildung in das digitale Zeitalter zu führen.
Dabei teilt die Agenda der Wissenschaft drei Rollen zu: Sie ist Mitgestalter, Innovationstreiber und Nutzer des digitalen Wandels.
1.) Die Gestaltung des Wandels und die Schaffung von Infrastrukturen zum Wohle aller sei gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Wissenschaft werde daher zusammen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren dauerhaft an der Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalen Agenda beteiligt, u.a. im Rahmen der neu auszurichtenden Nationalen IT-Gipfel. Die Bundesregierung vertritt die Digitale Agenda auch in internationalen Organisationen, in deren Multi-Stakeholder-Prozessen neben Akteuren aus Staat und Wirtschaft auch Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenwirken.
Ausdrücklich gefordert wird die Wissenschaft bei der fundierten und umfassenden Beurteilung und Gestaltung der digitalen Arbeitswelt und flexibler Arbeitsformen, der IT-Sicherheit, aber auch bei der Frage der Netzneutralität. Der Auftrag lautet umfassend:
„Die Wissenschaft muss die Digitalisierung selbst stärker zum Gegenstand der Forschung machen. Nur so kann sie den notwendigen Beitrag zur gesellschaftlichen und politischen Debatte um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit wie von Privatheit und Öffentlichkeit leisten.“
2.) Wissenschaft treibe, erkenne und setze Innovationen um und bilde damit eine Voraussetzung für einen erfolgreichen, wachstumsbegründenden digitalen Wandel. Die aktuellen Trends erkennt die Agenda als Industrie 4.0, die laut Schätzungen verspreche, die Produktivität von Unternehmen um 30 Prozent zu steigern, 3D, Smart Services, Big Data und Cloud Computing. Die Stärkung dieser Bereiche will die Bundesregierung fördern und fordern, nämlich von Wirtschaft und Wissenschaft, damit „Deutschland digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa wird.“ Wissenschaft wird hier zum Dienstleister am wissensgestützten Wirtschaftsraum.
3.) Und drittens spricht die Agenda Wissenschaft – Forschung und Bildung – als Nutzer der neuen digitalen Möglichkeiten an. Um beide Aufgaben erfüllen zu können – die Gestaltung, Beratung und Fundierung von Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse sowie der Antrieb von Innovationen –, benötigt Wissenschaft bestmögliche Bedingungen und die Freiheit, die Potentiale des digitalen Wandels ausloten. Hier sagt die Agenda, zurecht:
„Wissenschaftler wollen unkompliziert wissenschaftliche Informationen austauschen und über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten.“
Allerdings schließt daran unmittelbar die instrumentalisierende Forderung an, dass „Forschungsergebnisse schneller den Weg in innovative Anwendungen finden und damit zu neuem Wohlstand und sicheren Arbeitsplätzen der Zukunft beitragen.“
Das klare Bekenntnis der Bundesregierung, in Bildung, Wissenschaft und Infrastrukturen nachhaltig investieren zu wollen, findet in den konkreten Maßnahmen keine Entsprechung. Da ist von einer „neue Strategie“ und von Empfehlungen die Rede, die ein „Rat für Informationsinfrastrukturen“ abgeben soll. Am konkretesten ist noch die Ankündigung von „strategischen Projekte mit großer Hebelwirkung“ bei der Vernetzung von Forschungsdatenbanken und Repositorien sowie virtuellen Forschungsumgebungen. Die „Hebelwirkung“ lässt jedoch vermuten, dass damit gerade keine bundesweite Infrastruktur gemeint ist, sondern nur einzelne ‘strategische Leuchttürme’, mit denen sich die Hoffnung verbindet, dass sie die eigentlichen Infrastrukturinvestitionen der Wirtschaft auslösen oder erhebeln werden.
Ein Forschungsfeld hebt die Agenda hervor, da es die Grundlage für eine verantwortungsvolle Gestaltung durch Politik und für Akzeptanz und Vertrauen durch die Bürger ist: Den Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte, Selbstbestimmung und Transparenz. Doch auch hier bleiben die programmatischen Aussagen vage: Ein Forschungsforum „Privatheit“ und Studien zur Zukunft der Arbeit und zur Innovations- und Technikanalyse soll es geben.
Als positiv erachten wir die Ankündigung eines öffentlich finanzierten Forschungsinstituts, das „in einem interdisziplinären Ansatz die ethischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und partizipativen Aspekte von Internet und Digitalisierung erforschen“ und dabei die bestehenden Potenziale der deutschen Forschungslandschaft einbinden und fokussieren soll. Das Centre for Digital Cultures vereinigt unter seinem Dach zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die sich mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen und bietet sich als Partner für die Verfolgung dieses Ziels an.
Fazit: Aus einer geschlossenen Alpha muss schnell eine offene Beta werden
Das erklärte Ziel, die Digitale Agenda nicht allein an „Beamtenschreibtischen in den Ministerien entstehen zu lassen“, sondern sie gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Akteuren zu entwickeln – so Staatssekretärin Brigitte Zypries am 14. März 2014 vor dem Deutschen Bundestag – muss bisher als gescheitert betrachtet werden. Anhand der jetzt vom Bundeskabinett verabschiedeten Version kann nur konstatiert werden, dass es weder gelungen ist, ein kohärentes Konzept noch ein konkretes Maßnahmenpaket für die Gestaltung der Digitalisierung in Deutschland vorzulegen. Das ist zum einen auf die fehlende Einbeziehung der gesellschaftlichen Gruppen an dem Entstehungsprozess, aber auch an der unklaren Zuordnung der Kompetenzen bei dem ressortübergreifenden Thema Digitalisierung zurückzuführen. Im Ressort Digitale Gesellschaft des Infrastrukturministeriums heißt es: „Der kompetente Umgang mit dem Internet ist heute eine Schlüsselqualifikation“. Das gilt für die Bürger gleichermaßen wie für das Gestaltungshandeln der Regierung.
Bei weiteren Themen – den Herausforderungen bei der Sicherung der Netzneutralität, der Störerhaftung bei privaten Funknetzwerken, der Vorratsdatenspeicherung, dem Umgang mit Fair Use sowie dem Recht auf Remix, der Forderung nach stärkerer Berücksichtigung des Verbraucherrechts und von offenen und freien Bildungsmaterialien als wichtigem Bestandteil der Digitalisierung von Bildung und Forschung – schließen wir uns den Vorschlägen der Zivilgesellschaft und weiterer Gruppen an. Diese Themen sind zentral, um die „Chancen für eine starke Wirtschaft, gerechte Bildung und ein freies und sicheres Internet“ für alle nutzbar zu machen. Der Wissenschaft kommen dabei spezifische Aufgaben zu. Die Voraussetzungen für ihre Erfüllung zu schaffen, muss daher ein zentrales Ziel der Agenda sein.
Die Bundesregierung will „Deutschland zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln“ und „durch Forschung den digitalen Wandel verstehen“. Um diese und weitere Ziele zu erreichen, ist das CDC daran interessiert, gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen diesen Prozess aktiv zu begleiten. Es bleibt zu hoffen, dass der vorgelegte Text der Auftakt zu dem angekündigten und notwendigen umfassenden gesellschaftlichen Gespräch sein wird.
Prof. Dr. Volker Grassmuck und Christian Heise
für das CDC, Leuphana Universität Lüneburg
20. August 2014
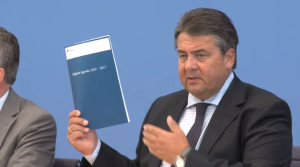






Pingback: Kollisionen und Konvergenzen - Grundversorgung 2.0
Pingback: Wir im Internet - Grundversorgung 2.0
Pingback: Update: Stellungnahme des CDC zur Digitalen Agenda der Bundesregierung - Grundversorgung 2.0